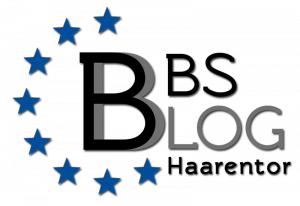Wie Phönix ohne Asche – eine zweite Ausbildung mit 36
Mein Gesicht ist von Schmerz verzerrt. Ich habe mir, zum zweiten Mal in in diesem Schuljahr, meine linke Hüfte im Sportunterricht auf unbekannte Weise verletzt. Meine Mitschüler:innen bewegen sich hingegen agil und spritzig mit einer körperlichen Naivität, die ich nur bewundern kann. Und da ist sie wieder, diese eine Frage: Warum bin ich hier und bin ich nicht zu alt für diesen Unfug? Zur Beantwortung dieser Existenzialität müssen wir zurück in das Jahr 2019, das Jahr, das mich mehrmals umbringen wollte.
Das Setting
Ich arbeitete als stellvertretende Teamleiterin bei einer Firma, die Inventuren in einer Supermarktkette durchführte. Im Januar hatten wir aufgrund von Jahresabschlüssen beim Kunden grundsätzlich frei und ich lag die meiste Zeit herum und versuchte mich zu erholen. In die Erholung schob sich langsam ein starker Schmerz in meinen linken Unterschenkel. So stark, dass ich zum Arzt ging. „Das ist der Ischias, ich verschreibe dir Schmerzmittel.“
Eine Woche später, der Schmerz ließ allmählich nach, rief mich meine Teamleitung an. Uns wurde die letzte freie Woche im Januar gestrichen, wir müssten Team Heilbronn eine Woche unterstützen. Ich wollte nicht, doch ich musste. Obacht beim Unterschreiben des Arbeitsvertrages, denn ich hatte mich zum Einsatz außerhalb von Oldenburg verpflichtet – falls ein anderes Team in Deutschland Unterstützung bräuchte. Also traf ich mich mit meiner Chefin an einem Sonntag um 8 Uhr, um knapp 600 Kilometer zu fahren.
Ein thrombotischer Jahresbeginn
Die Woche war äußerst anstrengend und mein linker Unterschenkel wurde praller und praller, röter und röter. Nach der ebenso langen Rückfahrt ging ich zu einem anderen Arzt. Diagnose: Wundrose mit Verschrieb von einem Antibiotikum. Vor dem Hintergrund meiner körperlich anstrengenden Arbeit wurde ich eine Woche krank geschrieben und arbeitete danach einfach weiter. Mein Bein war mittlerweile 1,5fach dicker als mein rechtes Bein und ich ging wieder zum Arzt, weil ich an manchen Tagen Probleme hatte Schuhe anzuziehen.
Ich solle zu einem Gefäßchirurgen und alle, die es schon einmal versucht haben wissen – ein Termin bei solch einem Spezialisten zu bekommen ist zeitnah nahezu unmöglich. Ich wurde von einer Arzthelferin sogar ausgelacht, weil ich im gleichen Jahr einen Termin wollte. Den Witz verstand ich nicht. Nach ewiger Suche kam ich im März bei einem Gefäßchirurgen in Nordhorn unter. Knapp 200 Kilometer entfernt und ich wäre noch weiter gefahren. Damit der Weg nicht zu langweilig wird, begleitete mich meine Mutter, was sich wenig später als Glücksgriff erwies.
Die Rückfahrt erfolgte nämlich liegend, denn offenbar lief ich drei Monate mit einer Thrombose herum. Der Chirurg und alle Mitarbeiter:innen der Praxis veranstalteten ein: „Bei welchem Stümper waren Sie? Sie hätten sterben können! Zack. Tot. Das ist gefährlich!“ Meine Name ist Nina, das L steht für Gefahr. Ich wusste nichts von meinem Grenzgang und dachte die ganze Zeit, wie ärgerlich es gewesen wäre in einem Supermarkt in Adolzfurt plötzlich umzukippen. Adolzfurt.

Mein neuer Freund war leider toxisch
Es folgten diesmal zwei Wochen Krankschreibung, inklusive viele Spritzen in den Bauch. Unweit vom Bauch entwickelte sich in den nächsten Wochen und Monaten das nächste Drama. Ein Bandscheibenvorfall. Um nicht auf der Arbeit zu fehlen, nahm ich täglich Novaminsulfon. Eine Packung war leer und der Arzt verschrieb 100 neue Tabletten. Bloß nicht krank machen, wir sind unterbesetzt. Der Kapitalismus ist ein nach unten tretendes Konstrukt und eine kranke Person, so hieß es bei uns im Team, lässt die Kolleg:innen im Stich. Dass die Firmenpolitik schon seit Jahren auf diesen Zustand hin arbeitete – egal. Krank zur Arbeit kommen war selbstverständlich und so lief ich jeden Tag wie Quasimodo auf der Arbeit herum. Bis zum 03.07.2019.
Die Wochen davor fühlte ich mich, als ob ich die Grippe des Jahrhunderts bekommen würde. Ich kann den Zustand nur mit einem diffusen und höchst intensiven Krankheitsgefühl beschreiben, was ich noch nie vorher erlebte. Trotzdem ging ich zur Arbeit. Und dann, am 03. Juli um kurz vor 8 Uhr, brach ich beim Zählen von Käseprodukten vor der Kühltheke zusammen. Meine Kolleginnen links und rechts sahen nichts (was ich mir schwerlich vorstellen kann) und so kramte ich meinen Körper zusammen, um im Aufenthaltsraum heulend zu stagnieren. Ich konnte nicht mehr. Generös sagte mir meine Chefin, dass ich nach Hause könne. Ich habe in letzter Zeit so tapfer gearbeitet. Was nicht stimmt, es war leichtsinnig, schädlich und fragwürdig. Ausbeuterische Arbeitsbedingungen sagen, es war tapfer.
Leukä-was?!
Zwei Tage später lag ich bei meiner Hausärztin (zu schwach, um zu sitzen) und wartete auf das Ergebnis meiner Blutentnahme nach dem Zusammenbruch auf der Arbeit. Sie betrat den Raum und sagte mir recht zügig, dass ich schwer krank sei, weil ich Leukämie habe. Kein Verdacht, keine nähere Untersuchung, sondern ein Faktum. Du hast Leukämie. Postwendend fing ich bitterlich an zu weinen. Woraufhin meine Ärztin sagte, dass ich schon nicht sterben müsse, die Behandlungsmöglichkeiten seien heutzutage sehr gut. Na wundervoll.
Mit Krankenwagen ging es daraufhin in eine von meiner Ärztin ausgewählte Onkologie. Während der Fahrt beschäftigten mich vor allem zwei Dinge: Erstens, warum die Türen des Krankenwagens zur Hälfte zugeklebt sind und ich ganz genau nichts sehen konnte und zweitens: warum? Natürlich gibt es keinen Grund für Unglücke, doch wenn eine Zäsur mit Betonpfahl auf dich fällt, hast du Fragen. Noch in der 30 Kilometer langen Fahrt kam ich zum Schluss, dass das jetzt wohl so ist. Ich bin dann jetzt die mit der Leukämie. Zudem war ich froh, dass ich es bin und nicht irgendjemand mit Mann/Frau oder gar Kindern.
Im Krankenhaus kam ich in ein leeres Dreibettzimmer, was meine innere Ödnis spiegelte. Umzingelt von einem Geschwader an Ärzt:innen prasselten haufenweise Fragen auf mich ein. Haben Sie Novalgin genommen? Rauchen Sie? Welche Beschwerden haben Sie seit wann? Hatten Sie in den letzten Tagen Fieber? Auf einer Stufe von eins bis… – Ich nahm alles nur verschwommen wahr. Das Geschwader verflog, mein Zimmer wurde unter Quarantäne gestellt und ich sah den Bäumen vor dem Fenster zu, wie sie sich dem Wind beugten.
Drei Wochen auf der Onkologie

Was war da nun passiert? Ich kam mit einer glasklaren Symptomatik, einer Leukämie, ins Krankenhaus und, Obacht Spoiler, ich hatte im Endeffekt keine. Mein Immunsystem war nicht vorhanden (deswegen die Quarantäne), ich hatte Fieber und unter meiner linken Achsel eine diffuse Entzündung, die sich von der Größe einer Haselnuss zu der Größe einer Melone wandelte. Kurzum stand ich kurz vor einer Sepsis und ohne Behandlung wäre ich gestorben. Schon wieder.
Diese Krankheit heißt Agranulozytose und ist eine sehr seltene Nebenwirkung (<1 von 10.000 Patient:innen) von dem Schmerzmittel, was über Monate hinweg mein treuer Begleiter (eher treuer Vergifter) war: Novaminsulfon.
Dieses Medikament ist in vielen Ländern aufgrund der Gefahr einer tödlichen Vergiftung nicht zugelassen, in Deutschland gehörte es 2019 zu den 25 Medikamenten mit dem größten Umsatz.
Drei Wochen lag ich auf der Onkologie und Hämatologie und es war so prägend, dass fast kein Tag vergeht, an dem ich nicht daran denke.
Memories
Gedanken an meine Bettnachbarin, die sich andauernd übergab und vor Schmerzen stöhnte. An meinen täglichen Verbandswechsel (die Melone unterm Arm ging irgendwann auf; ich hätte da Bilder bei Interesse), bei dem ich regelmäßig vor Schmerzen alles wegtrat, was sich in meinem Bett befand. Wie ein Arzt mir nekrotisches Fleisch aus der Wunde zog und natürlich die Punktion meines Beckenkamms, bei der ich eigentlich eine leichte Narkose bekommen sollte. Nur wirkte die nicht und ich schrie und heulte hemmungslos im Angesicht des stärksten Schmerzens, den ich bis dato verspürte. Nicht empfehlenswert.
Zudem ersetzte der Oberarzt mein Antidepressivum, weil mein bis dato eingenommenes Medikament negative Auswirkungen auf die weißen Blutkörperchen haben kann. Und diese Körperchen waren ja Mangelware. Ein schneller Entzug von einem Antidepressivum kann die Hölle sein und ich befand mich mindestens im Fegefeuer. Ich wusste gar nicht, dass mein Kopf solche Schmerzen produzieren kann. Beeindruckend. Und ich weinte bei jeder noch so kleinen Begebenheit. An einem Tag sah ich morgens eine Zoosendung, in der ein Eisbär zum Geburtstag von seinem Pfleger eine „Eistorte“ geschenkt bekam. Das fand ich so rührend, dass ich bis zum Nachmittag flennte.
Da war doch noch was..?
Nun möchte man meinen, dass dies das Ende der Geschichte vom Horrorjahr war, aber da war noch dieser Bandscheibenvorfall. Im Krankenhaus hatte ich kaum bis gar keine Beschwerden, was aber vermutlich am Übermaß an Antibiotika lag. Doch schon kurze Zeit nach der Entlassung fingen die Beschwerden erneut an – in einer sich stetig steigernden Intensität, die mich schließlich dazu brachte, dass ich kaum noch laufen konnte. Und wenn, dann humpelnd mit dem linken Ellenbogen unter meiner linken Hüfte platziert. Probiert es mal aus.
Ich versuchte jede verfügbare Option, um mir Linderung zu verschaffen, doch nichts wirkte. Keine Opiate, keine Spritzentherapie und keine Bewegung. Mit jedem Tag wurde meine Verzweiflung größer. Ich wollte einfach nur laufen, Freunde besuchen, leben. Stattdessen lag ich jeden Tag mit Schmerzen flach. Social Distancing, bevor es jede:r machte.
Dabei sang ich weinend, im tiefen Tal der Traurigkeit und unfähig das Haus zu verlassen, Lieder von Arielle – die Meerjungfrau (Flossen mit Schmerzen ersetzt):
Schmerzen, die tragen nicht allzu weit, denn man braucht Beine zum
Springen, Tanzen, um zu spazieren und zu – wie heißt noch das Wort?- gehn!
Einmal Krankenhaus geht noch
Mein Prinz Eric war der Oberarzt der Neurochirurgie, der mir tief in die Augen blickte und sagte, dass er meine Schmerzen völlig versteht („Das haben Sie so lange ausgehalten?“) und ich ohne Operation keine Chance auf Besserung habe. Operationen am Rücken haben irgendwie einen schlechten Ruf und als ich Bekannten und Freunden von meinem Entschluss erzählte, meinten viele, dass ich es mir noch einmal überlegen solle. Weil da wären schon Dinge schief gelaufen.
Ich war zu dem Zeitpunkt jedoch so am Ende mit allem, dass ich zwischen Operation und freiwilliger Selbstaufgabe meines Lebens stand. Da schien mir das „Risiko“ mit dem chirurgischen Eingriff sehr überschaubar. Am 29.11.2019 war es endlich so weit.
Am Vortag musste ich für Untersuchungen im Krankenhaus sein und kam wieder auf ein Dreibettzimmer – nur diesmal schon mit zwei Omas, die nicht mit mir sprachen. Zu meinem Glück wurden beide am Morgen des 29. entlassen und ich war alleine, lüftete das Zimmer und wartete aufgeregt im OP-Hemd darauf aufgeschnitten zu werden.
Aber nicht ohne Komplikation
Die Operation ging ca. 5-6 Stunden und es ging mir danach fabelhaft. Eigentlich hätte ich direkt aufstehen können, aber beim Eingriff war eine Komplikation eingetreten. Mir wurde meine Dura verletzt, d.h. ich hatte Hirnflüssigkeit verloren und durfte nach der Operation 24 Stunden nicht aufstehen. Yeah. Nachts wurde ich stetig von Pfleger*innen geweckt und gefragt, ob ich Kopfschmerzen habe. Ich hatte nur ganz viel müde.
Nachdem meine Bettruhe vorüber war, durfte ich aufstehen und wie von Zauberhand waren meine Schmerzen weg. Einfach so. Meine Mutter verhielt sich wie die Angehörige von einer Person, die während eines Gottesdienstes den Rollstuhl verließ. „Oh mein Gott! Sie läuft! Sie läuft!“
Für die an Details interessierten Menschen: an den Bandscheiben LWS 4/5 links wurde mir überstehendes Gewebe entfernt, die Bandscheibe geöffnet, feucht durchgewischt und schließlich alles zugetackert. Die Tackernadeln befinden sich in einem kleinen Beutel, der immer in meiner Handtasche ist. Nach dem Ziehen der Nadeln übergab mir die Arzthelferin selbige so stolz, dass ich nicht ablehnen wollte und jetzt glaube ich, dass ein Entsorgen Unglück bringt.
Verletzungen, die unter ferner liefen
Puh, was ein Jahr. Ob das alles war? Natürlich nicht. Im Sommer hatte ich mir meine linke Kniescheibe geprellt, weil ich nachts das offene Schlafzimmerfenster vergaß und beim Wälzen im Bett die Ecke des Fensters mit voller Wucht meiner Kniescheibe begegnete.
Im Oktober ließ ich mir einen Weisheitszahn ziehen und der Dezember war dann für eine neurogene Blasenstörung reserviert. Ihr erinnert euch an die 24 Stunden Bettruhe nach der Operation? Tja, ich habe keinen Katheter bekommen und mein Körper verweigerte sich in eine Bettpfanne zu entleeren. Also war ich insgesamt über 30 Stunden nicht pinkeln und das kann gesundheitliche Folgen haben. Eigentlich logisch, aber da ich häufiger „Ich gehe 24 Stunden nicht pinkeln“- Challenges auf YouTube sehe, überraschenderweise erwähnenswert.
Jahreswechsel. Ich freute mich so sehr auf 2020. Als ob das Ende einer Haftstrafe abgesessen war. Ich hatte trotz aller Hürden überlebt und freute mich auf die sechswöchige Reha Anfang Januar. Schön entspannen, wieder mobil werden und dann geht das alles weiter. Ganz normal. Tja. Konnte ja niemand ahnen, dass 2020 meine persönlichen Traumata des Vorjahres gesamtgesellschaftlich spiegelte. Aber erst mal ließ ich es mir in Bad Sooden-Allendorf gut gehen.

Ein Resümee
Eine Rehabilitation ist aber natürlich darauf gezielt wieder auf den Arbeitsmarkt geschmissen zu werden. Aber wollte ich dahin zurück? War ich nicht zu mehr fähig als die Anzahl von Tiefkühlpommes in ein Gerät zu tippen? Ich konnte schließlich als einzige Person im Team den Drucker reparieren (Klappe öffnen und wieder schließen). Aber machen wir uns nichts vor, mein Lebenslauf gleicht einem Flickenteppich ohne Richtung und so richtig kann ich eigentlich nichts.
Realschule, Höhere Handelsschule, Friseurausbildung, Promoterin, Kolleg, Bachelor in Soziologie, Fahrgastbefragerin, Zeitungsausträgerin, fast den Master in Kulturanalysen und zum Abschluss Inventurzählerin. Schreit nicht nach Konsistenz und alle beruflichen Beratungsstellen, die ich Anfang 2020 aufsuchte, bestätigten mir, dass ich mich vor dem Hintergrund meiner Lebensentscheidungen nicht über Ziellosigkeit wundern dürfe. Und einer meinte, dass ich Schließerin werden sollte.
Ich bin ein Phoenix, wo ist meine Asche?
Da war ich nun. Ein rehabilitierter Vogel, wiedergeboren und bereit für einen Neuanfang. Nur leider ohne finanzielle Mittel, depressiv und mitten in einer Pandemie. Die Welt ist ein fahrendes und temporär brennendes Karussell und ich versuchte meinen Platz zu finden – ein Phönix ohne Asche.
Was nun? Resignation mit 36 Jahren ist doch recht früh und Schließerin wollte ich nicht. Da ich schon immer gerne neue Dinge lernte, war es nicht gänzlich ausgeschlossen, eine zweite Ausbildung anzufangen. Die Wahl meiner ersten Ausbildung lag darin begründet, dass ich gerne mit Haaren herumfummle. Hochstecken, schick machen. Dass der Arbeitsalltag auch daraus bestand, wie Chewbacca mit Haaren überzogen, der Frau mit den vielen Grützbeuteln eine Kopfmassage zu geben, ja, dies sagte mir vorher niemand. Desillusion der Träume, die ich mit 17 hatte. Zudem hatte ich mir zu keinem Zeitpunkt Gedanken über die körperlichen Belastungen im Laufe des Berufslebens gemacht. Von der schlechten Bezahlung ganz abgesehen. Meine Eltern sagten immer, dass Handwerk eine sichere Bank sei. Selbige haben auch Bertelsmann-Lexika als Wertanlage gekauft.
Heute
Nun, 19 Jahre später, fühle ich mich definitiv besser vorbereitet und mich wählte ein Betrieb aus, in dem ich mich wohl fühle und ich lerne einen Beruf, der Zukunft hat. Das Wahlverfahren habe ich mit Absicht passiv formuliert, denn trotz aller Anstrengungen und Bewerbungen, muss dir am Ende jemand eine Chance geben. Ob ich vor Freude geweint habe, als ich von meiner Zusage erfuhr? Definitiv. Weniger schamhaft zu erzählen, als die Geschichte mit der Eistorte.
In meinem Betrieb wird mir vertraut und dementsprechend viel Verantwortung gegeben. Dies ist auf jeden Fall ein Nebeneffekt des Alters und ich bin mir bewusst, dass ich vor 19 Jahren diese Vorteile nicht gehabt hätte. Sogar ich hab mir vor 19 Jahren nicht vertraut. Ich erinnere mich noch daran, dass die Ausbilderin meiner Friseurausbildung innerhalb der ersten Wochen zu mir kam und mir sagte wie schwach (im Sinne von grottenschlecht) ich sei. Nach drei Jahren gehörte ich zu den besten Auszubildenden, die sie jemals hatte.
Mit dieser kleinen Anekdote möchte ich den Schluss einläuten. Leben heißt nicht, dass man alles richtig macht und linear den Weg ins Grab findet. Vielleicht beginne ich in 10 Jahren meine dritte Ausbildung – niemand könnte mich hindern. Ein Neuanfang ist immer möglich. Mit 36 oder zig Jahre später. Es gibt kein Versagen, nur gute Geschichten.